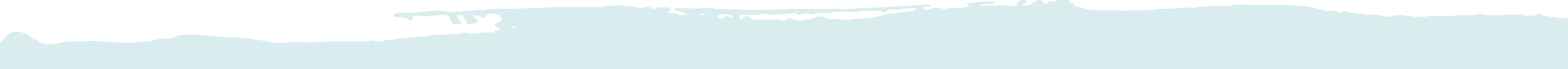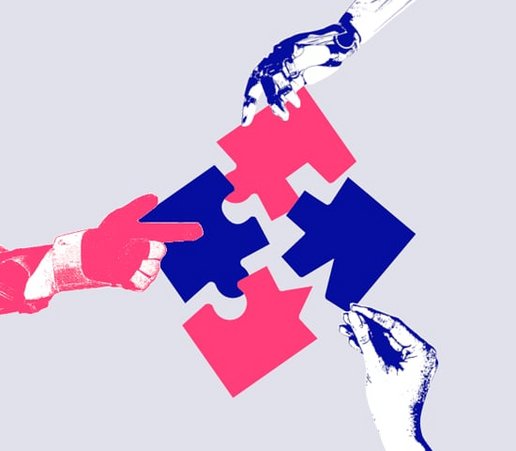Eine Gesundheitsversorgung ist in Deutschland nicht für alle Menschen gleichermaßen sichergestellt. Sichtbar wurde dies während der Corona-Pandemie, als sich antiasiatischer Rassismus und Diskriminierung nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch im Gesundheitswesen zeigten.
Die wissenschaftliche Datenlage zu Rassismus in Deutschland ist im Allgemeinen und auch für das Gesundheitswesen bisher lückenhaft. Der Nationale Diskriminierungs- und Rassismusmonitor (NaDiRa) am Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung (DeZIM) geht dagegen vor. Auf Basis unterschiedlicher Datenquellen können durch ihn dauerhaft verlässliche Aussagen über Ursachen, Ausmaß und Folgen von Diskriminierung und Rassismus in Deutschland getroffen werden.
Schwerpunkt Gesundheit und gesundheitliche Versorgung
Der aktuelle Bericht "Rassismus und seine Symptome" widmet sich dem Schwerpunkt Gesundheit und den dortigen Erfahrungen mit Diskriminierung und Rassismus. Es geht sowohl um die Perspektiven der gesamten Bevölkerung als auch um die der unmittelbar von Rassismus Betroffenen. Damit knüpft er an die Auftaktstudie "Rassistische Realitäten" des NaDiRa vom Mai 2022 an. Der diesjährige Fokus liegt unter anderem auf dem Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen, Diskriminierungs- und Rassismuserfahrungen bei deren Nutzung und den Auswirkungen auf die Gesundheitsversorgung.
Diskriminierungserfahrungen weitverbreitet
Es zeigt sich: Diskriminierungserfahrungen sind in Deutschland weitverbreitet. Prof. Dr. Naika Foroutan, Direktorin des DeZIM-Instituts, hebt hervor: "Am häufigsten trifft es Bevölkerungsgruppen, die rassistisch markiert sind und deren Zugehörigkeit zu Deutschland immer wieder Gegenstand der öffentlichen Debatten ist: Schwarze, asiatische und muslimische Menschen." Diskriminierungserfahrungen erfolgen dabei mehrheitlich aufgrund rassistischer Merkmale, wie mangelnde Sprachkenntnisse, Migration nach Deutschland, nichtdeutsch klingende Namen, religiöse Zugehörigkeit oder Hautfarbe.
Namensbasierte Diskriminierung
Rassistische Diskriminierung findet schon beim Zugang zur Gesundheitsversorgung statt: Trotz identisch formulierter Terminanfragen bekommen Menschen mit einem Namen, der in Nigeria oder der Türkei verbreitet ist, seltener einen Termin in einer Praxis als Menschen mit einem deutsch gelesenen Namen.
Volltextalternative der Grafiken
Rassismuserfahrungen und mentale Gesundheit korrelieren
Die Berichtsergebnisse verdeutlichen, dass sich mit zunehmender Diskriminierungs- und Rassismuserfahrung auch die individuelle Gesundheitswahrnehmung der Betroffenen verschlechtert. Zudem steigen die Symptome einer Angststörung und depressiven Erkrankung an. Viele machen die Erfahrung, dass ihre Beschwerden medizinisch nicht ernst genommen werden. Dies kann nicht nur zu Fehldiagnosen führen, sondern auch die Gesundheit gefährden, wenn beispielsweise Menschen aus Angst vor Diskriminierung Arztbesuche vermeiden. Hierbei werden zusätzlich geschlechterspezifische Unterschiede sichtbar. Frauen geben häufiger an, dass sie bereits die Ärztin oder den Arzt wechseln mussten, als Männer.
Rassismus in der ärztlichen Ausbildung
In medizinischen Lehrmaterialien werden rassistisch markierte Gruppen weitgehend nicht berücksichtigt. Zum Beispiel kommen Personen mit dunklen Hauttypen in dermatologischen Lehrmitteln fast nicht vor. Werden sie berücksichtigt, geschieht dies häufig im Zuge einer Verortung jenseits vermeintlich westlicher Normen und Werte.
Gleichzeitig werden sie durch spezifische Zuschreibungen stereotypisiert und häufig mit bestimmten Krankheitsbildern (HIV, Tuberkulose) oder Verhaltensweisen (Alkohol- und Drogenkonsum) verknüpft, was zu unterschiedlichen Formen der Benachteiligung führen kann. Schwarze Frauen bekommen etwa in Folge von Hypersexualisierung häufiger HIV/STI-Testungen angeboten, wohingegen muslimisch gelesenen Frauen eine unterdrückte Sexualität zugeschrieben wird.
Grundvertrauen sinkt – wie weitermachen?
Diskriminierung und Rassismus gehen über die unmittelbaren Folgen für die Betroffenen hinaus und schaden mittelbar auch der Gesellschaft. Besonders wenn Diskriminierungen in Institutionen passieren, die eigentlich zum Schutz der Menschen und als Hilfsräume aufgesucht werden, kann das zu Vertrauensverlusten führen. Prof. Dr. Frank Kalter, Direktor des DeZIM-Instituts, empfiehlt, auf Basis der Ergebnisse und Handlungsempfehlungen des Berichts gezielte präventive Maßnahmen zu entwickeln, um Betroffene und zivilgesellschaftliche Organisationen besser unterstützen zu können.
Im Bericht wird dazu geraten, die Forschung auszubauen und dabei auch Mehrfachbenachteiligungen gezielt in den Blick zu nehmen. Zudem enthält er die Empfehlung, medizinische Forschung interdisziplinärer zu gestalten und geschlechtsbasierte Diskriminierung mit Forschung zu Rassismus zu verknüpfen.
Des Weiteren ist es wichtig, Diskriminierung und Rassismus umfassend in institutionellen Kontexten zu thematisieren und diskriminierende Wissensbestände in der medizinischen Versorgung durch Ausbildung und Fortbildung des medizinischen Personals abzubauen. Das Gesundheitssystem muss frei von Rassismus und Diskriminierung werden, um das Vertrauen der Menschen in dieses nicht zu verlieren.
Veröffentlicht im Februar 2024